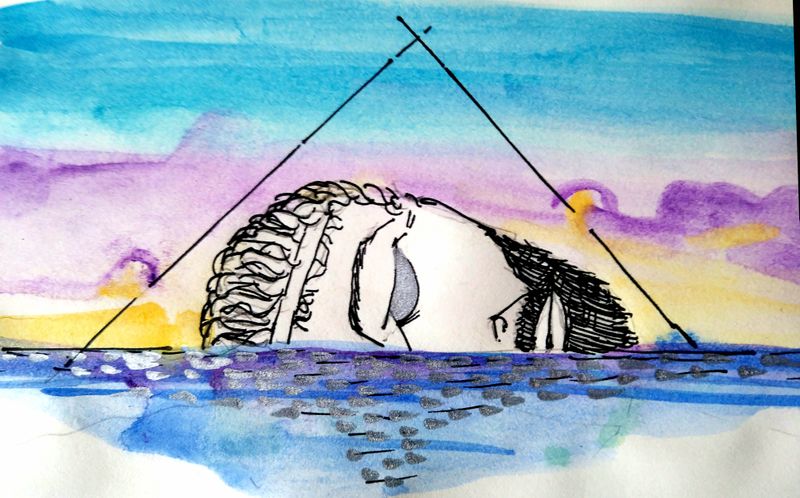
Zeit der Verluste
Altwerden mag einen auf sich selbst zurückwerfen. Aber es ist nie nur eine individuelle Angelegenheit, auch wenn wir hierzulande dazu neigen, das Altwerden zu entsozialisieren.
Der Kampf meiner Schwiegermutter gegen ihr Altern hatte von Anfang an – und da beginnt schon das dialektische – von Anfang an zwei Fronten. Es fiel ihr immer schwerer, ihren Alltag zu bewältigen. Selbst kleine Verrichtungen wurden im Lauf der Zeit unerfüllbar. Es wurde also zu unserer Aufgabe, einzuspringen und ihren brüchiger werdenden Alltag zu stabilisieren. Gleichzeitig wuchsen in ihr Schmerz und Widerstand gegen die zunehmende Brüchigkeit. Je größer der Schmerz, desto vehementer der Widerstand.
Einige Jahre vor dem Umzug in das Pflegeheim, hatten wir ihr, um sie versorgt zu wissen, einen Platz in der ambulanten Tagespflege organisiert. Aber zunächst weigerte sie sich zu den Alten zu gehen. Sie gehörte nicht zu den Tattern, den dumpfen Greisen mit ihren offenen Mündern. Was sollte sie da, sie konnte doch alles noch selbst verrichten und hatte alles, was sie brauchte? Ihre Wohnung, das Einkaufszentrum, den Fernseher.
Mich ärgerte das damals. Sie war selbst in den 80ern und teilte die Eigenschaften jener Tatter, mit denen sie nichts zu tun haben wollte. Und den Plapperkasten Menschen vorzuziehen, verstand ich schon gar nicht, zumal sie unaufhörlich ihre Einsamkeit und Langeweile beklagte.
Viele Kinder und Angehörige von Hochaltrigen geraten in diese unglückliche Dialektik aus Verantwortung und Verweigerung. Das Gespräch, das hier stattfindet, ist geprägt von Missverstehen, Überhören und Ignorieren, aber es findet statt. Mir scheint, der Ursprung dieses missglückten, desolaten Gesprächs ist Furcht.
was sie fürchtete, war die Begegnung mit den anderen. Die Begegnung mit sich selbst, ihren Zustand im Zustand der anderen. Das plötzliche, bestürzende Du im ichgewohnten Leben. Und damit einhergehend das Einsehenmüssen, nicht (mehr) die zu sein, die sie glaubte zu sein. Doch wer dann?
Darauf wirft einen das Älterwerden zurück. Auf die Frage wer bin ich? Wer werde ich? Und zugleich die Frage nach der Selbstverfügbarkeit. Irgendwann „gehen dem Leben die Möglichkeiten aus“ (John Updike). Durch das Altern, merken wir in einem allmählichen Schmerz, dass der Glaube, „alles verbessern oder als Ausgangsort nutzen“ zu können, um wieder neu anzufangen, eben nicht mehr ist, als es ist: Ein Glaube. (D. Schreiber, die Zeit der Verluste, Berlin 2023, 34)
Ich will nicht sagen ein Irrglaube, denn das Ganze bringt einen ja irgendwohin. Aber den Schmerz um die Wirklichkeit des Älterwerdens müssen wir dabei verdrängen. Und dieses Verdrängen beginnt weit früher als zum Zeitpunkt der Notwendigkeit einer Tagesambulanz.
(Zumin40er Geburtstag dest hatte ich diesen Eindruck bei meiner Schwiegermutter. Ich dachte eine Weile, dass die Demenz letztlich eine Erleichterung für sie ist und jenen Schmerz im Abstand des Vergessens hält. Aber das trifft nicht zu.
„Wie geht es dir?“, fragte meine Frau sie. Und wie immer antwortete sie mit einem runden „Mir geht’s gut.“ Nur um sich ein paar Augenblicke später im Bett halb aufzurichten und nüchtern festzustellen: „Das ist doch alles Scheiße.“ Wir lachten über den Kraftausdruck. „Es geht dir also nicht gut?“, hakte meine Frau nach. Ihre Mutter sah sie ein bisschen erstaunt an und erwiderte: „Doch, mir geht’s gut.“ Zu sagen, wie es ist und zu sagen, was sich gehört, beides liegt in der Demenz unmittelbar nebeneinander. Was verworren und komisch wirkt, ist es nur deshalb, weil es keine Übergangs- und Umgangsformen mehr gibt, die filtern und eine Situation stimmig machen. Die Person in der Demenz wird nicht aufgelöst. In mancher Hinsicht tritt sie in ihrer Unmittelbarkeit hervor.
Thomas Fuchs schreibt: „Selbst dann, wenn eine Demenzerkrankung einen Menschen seiner expliziten Erinnerungen beraubt, behält er noch immer ein implizites, leibliches Gedächtnis: Seine Lebenssgeschichte bleibt gegenwärtig in den vertrauten Anblicken, Gerüchen, Berührungen und Handhabungen der Dinge, auch wenn er sich über den Ursprung dieser Vertrautheit keinerlei Rechenschaft mehr ablegen und seine Geschichte nicht mehr erzählen kann.“ (T. Fuchs, Zeitdiagnosen, Zug 2002, S. 79). Doch wer erzählt sie dann?a